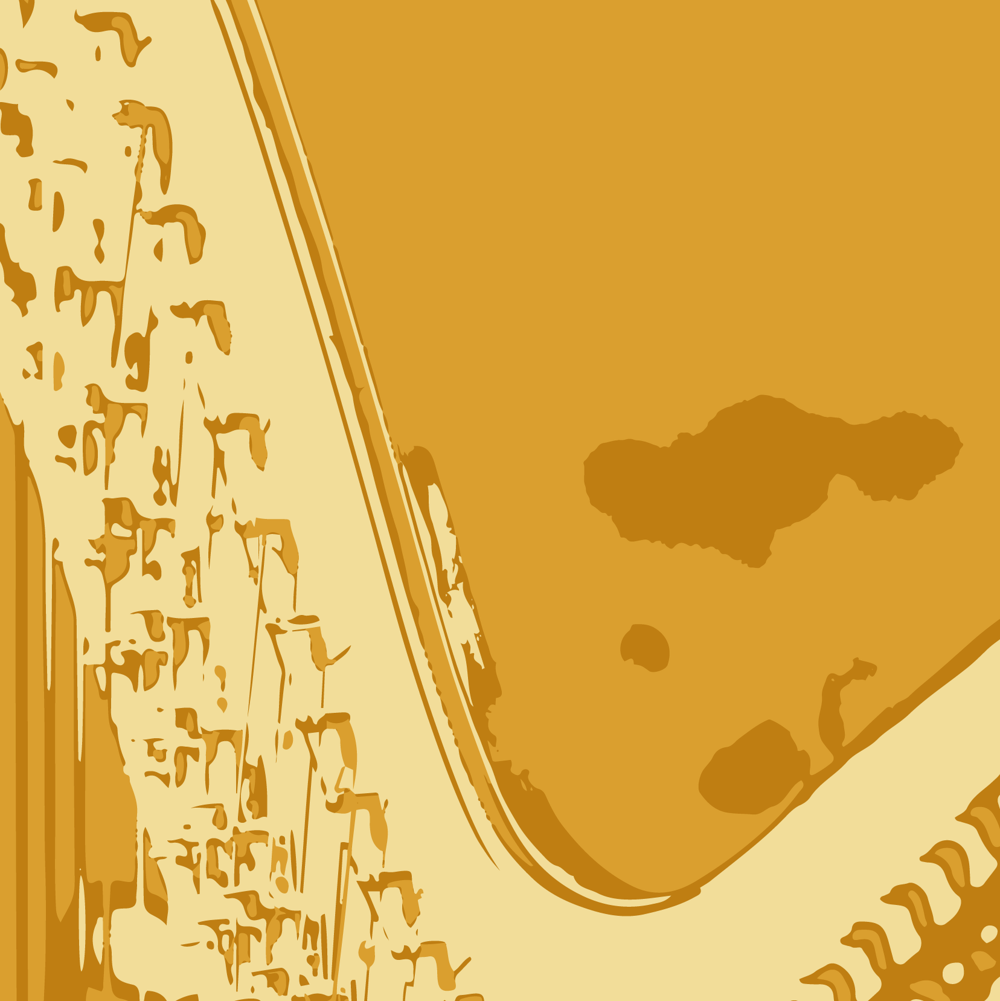VON KOPENHAGEN NACH VENEDIG mit Orginel² und Saxobefont
Orginel² und Saxobefont. Dieses junge Duo besteht aus der oberösterreichischen Organistin Theresa Zöpfl und der burgenländischen Saxophonistin Elisa Lapan. Seit der Gründung 2016 erschließen die beiden Musikerinnen außergewöhnliche Klanglandschaften ihrer beiden Instrumente – so auch bei der MUSIK AM MITTAG im Linzer Mariendom am 4. September 2022. Die musikalische Reise VON KOPENHAGEN NACH VENEDIG begeisterte mit Werken von Carl Nielsen, Alessandro Marcello, Niels Wilhelm Gade und Ad Wammes.
Fantasievoll!
Mit einem eigenen Arrangement für Sopransaxophon und Orgel von Carl Nielsens Fantasistykker for obo og klaver, op. 2, eröffnete das Duo Orginel² und Saxobefont seine Reise VON KOPENHAGEN NACH PARIS. Carl Nielsen, 1865 in Sortelung bei Nørre Lyndelse geboren, wuchs als eines von zwölf Kindern in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater war Tagelöhner und Maler, aber durchaus auch musikalisch veranlagt: Denn er spielte Violine und Kornett und musizierte mit einem Trio bei Festen auf der gesamten Insel Fünen. Carl Nielsen erhielt darum auch früh Gegenunterricht und war bald schon mit seinem Vater als Tanzmusiker unterwegs. 1879 wurde Nielsen ins Regimentsmusikkorps in Odense aufgenommen, wo er Signalhorn und Altposaune spielte. Daneben nahm er Unterricht in Violine bei Kantor Carl Larsen, der in ihm das Interesse für Johan Sebastian Bach weckte. 1883 reiste er – finanziell von Wohltätern unterstützt – nach Kopenhagen, wo er von Niels Wilhelm Gade, Leiter von Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, als Stipendiat mit Violine als Hauptfach aufgenommen wurde. Das Konservatorium besuchte er von 1884 bis 1886, wobei insbesondere der Unterricht in Musiktheorie bei Orla Rosenhoff wegweisend für Nielsen gewesen sein dürfte. In der Zeit der Entstehung der Fantasistykker (1889) beteiligte sich der Komponist an der Gründung der Kammermusikvereinigung Symphonia, die beabsichtigte, jungen Musikschaffenden eine Heimat zu bieten und Werke dänischer Komponisten zur Aufführung zu bringen – Nielsen verließ selbige aber bereits wenige Jahre später wieder. Im Spätsommer 1889 wechselte Nielsen von seiner Substitutentätigkeit im Orchester des Konzertsaals im Tivoli zur Hofkapelle (Det Kongelige Kapel), wo er als zweiter Geiger wirkte. 1890 erhielt er das Stipendium Det Anckerske Legat, mit dem er eine Studienreise nach Deutschland, Frankreich und Italien machte. In Paris lernte er die Bildhauerin Anne Marie Brodersen kennen, die er noch auf seiner Studienreise ehelichte. Mit seiner Ersten Symphonie, op. 7, eroberte sich Nielsen 1894 einen Platz in der vordersten Reihe der jüngeren Komponisten Dänemarks. Ab 1901 erhielt er einen jährlichen Betrag vom Staat, 1903 bis 1924 hatte er außerdem einen Vertrag mit dem Musikverlag Wilhelm Hansen, der ihm neben dem Unterricht von Privatschüler:innen sein jährliches Einkommen sicherte. 1905 beendete er seinen Dienst als Violinist der Hofkapelle, 1908 wurde er zum Zweiten Kapellmeister an Det Kongelige Teater in Kopenhagen berufen, das Amt legte er aber 1914 wegen Unstimmigkeiten mit der Leitung nieder. 1915 bis 1927 war Nielsen Dirigent der Musikforeningen und nach Aufnahme in die Direktion von Det Kongelige Danske Musikkonservatorium unterrichtete er an dieser Einrichtung von 1915 bis 1919. Nach einem Herzanfall 1922 war Nielsens Arbeitsfähigkeit bis zu seinem Tod im Oktober 1931 eingeschränkt, dennoch übernahm er Anfang des Jahres 1931 noch das Amt des Direktors des Musikkonservatoriums.
Die zwei Fantasistykker standen am Anfang von Carl Nielsens Weg zu einem der wichtigsten und erfolgreichsten Komponisten Dänemarks. Die ruhig dahinschreitende Romance, die laut den ersten Quellen wohl für Oboe und Orgel gedacht war, entstand im November 1889; im März 1890 folgte die bewegte Humoresque. Bis zur Drucklegung Ende 1890/Anfang 1891 im Verlag Wilhelm Hansen überarbeitete Nielsen das Werk im Sommer 1890 noch mehrfach, wie Lisbeth Ahlgren Jensen in ihrem kritischen Bericht zum Werk festhält. Auch die Bezeichnung Fantasistykker dürfte erst im Rahmen der Drucklegung entstanden sein, in seinen Briefen und Tagebüchern bezeichnet Nielsen sie stets als Obostykker. Daneben wurde bei der Drucklegung auch der Widmungsträger geändert: Während im frühen Einzelautograph der Romance noch Oboist Peter Brøndum angegeben ist, erscheint in der Erstausgabe Olivo Krause, Nielsens Kollege in Det Kongelige Kapel, als Widmungsträger. Brøndum hatte die Romance bereits im Dezember 1889 in der Privat Kammermusikforening aufgeführt, im April 1890 die Humoresque in einem nicht näher beschriebenen Rahmen. Nach einer privaten Aufführung der beiden Fantasistykker im September 1890 in Dresden mit Carl Nielsen an der Geige und Victor Bendix am Klavier erklangen die Fantasistykker gemeinsam erstmals öffentlich am 16. März 1891 in Kopenhagen im Rahmen einer Det Kongelige Kapels Soiré mit Olivo Krause an der Oboe und Victor Bendix am Klavier.
Carl Nielsen (1865–1931): Fantasistykker for obo og klaver, op. 2: 1. Romance. Andante con duolo | Orginel² und Saxobefont (Saxophon: Elisa Lapan | Rudigierorgel: Theresa Zöpfl)
In einer Programmnotiz von 1922 beschrieb der Komponist die zwei Stücke retrospektiv wie folgt: „De to Obostykker er et meget tidligt Opus. Det første – langsomme – Stykke giver Oboen Lejlighed til at synge sine Toner ud saa smukt som dette Instrument netop kan. Det andet er mere humoristisk, skalkagtigt, med en Undertone af nordisk Natur og Skovpusleri i Maanelys.“ (Deutsche Übersetzung: „Die beiden Oboenstücke sind ein sehr frühes Werk. Das erste - langsame - Stück gibt der Oboe die Gelegenheit, ihre Töne so schön herauszusingen, wie es dieses Instrument kann. Das zweite ist eher humorvoll, schelmisch, mit einem Unterton von nordischer Natur und Waldrauschen im Mondlicht.“, im Original zit. nach: Ahlgren Jensen, Lisbeth: Preface. In: Ahlgren Jensen, Lisbeth / Bruunshuus Petersen, Elly / Flensborg Petersen, Kirsten (Hrsg.) (2003): Carl Nielsen. Værker, Serie II, Bd. 11. Kopenhagen: Carl Nielsen Udgaven – Det Kongelige Bibliotek. S. xxiv.)
In den Fantasistykker (Romance: Andante con duolo und Humoresque: Allegretto scherzando) sind sehr persönliche Züge des Komponisten zu erkennen, wie auch das Aftenbladet in der Konzertkritik vom 17. März 1891 bemerkte: „Det er ikke almindelige og forkjørte Motiver, Hr. Carl Nielsen anvender, men støt og rolig gaar han sine egne Veje. Derfor tør man sikkert knytte store Forhaabninger til den unge Kunstners Fremtid.“ (Deutsche Übersetzung: „Es sind keine gewöhnlichen und trivialen Motive, die Hr. Carl Nielsen verwendet; vielmehr geht er steten und gelassenen Schrittes seine eigenen Wege. Man darf daher sicher große Hoffnungen in die Zukunft des jungen Künstlers setzen.“, im Original zit. nach: Ahlgren Jensen, Lisbeth: Preface. In: Ahlgren Jensen, Lisbeth / Bruunshuus Petersen, Elly / Flensborg Petersen, Kirsten (Hrsg.) (2003): Carl Nielsen. Værker, Serie II, Bd. 11. Kopenhagen: Carl Nielsen Udgaven – Det Kongelige Bibliotek. S. xxv.)
Barock!
Alessandro Marcellos Concerto per Oboe in re minore mit den Sätzen Andante e spiccato und Adagio in einem Arrangement für Sopransaxophon und Orgel von Charles Frison entführte das ORGEL.SOMMER-Publikum schließlich ins Venedig der Barockzeit.
Der 1673 (oder möglicherweise auch bereits 1669) in Venedig geborene Alessandro Marcello entstammt einer venezianischen Patrizierfamilie – sein jüngerer Bruder Benedetto betätigte sich ebenfalls musikalisch. Nach Violinunterricht bei seinem Vater nahm er vermutlich Unterricht bei Giuseppe Tartini. Im Anschluss an den Besuch des Collegio dei padri Somaschi studierte er Mathematik und Philosophie an der Universität Padua. Marcello beherrschte sieben Sprachen und ließ sich in Malerei, Komposition und Dichtung unterweisen. Das Mitglied im venezianischen Maggior consiglio und in weiteren zwölf Akademien unternahm Reisen durch Frankreich und die Niederlande und pflegte Kontakte, auch ins Ausland, zu Patriziern, Geistlichen und Gelehrten. Neben der Violine beherrschte Marcello auch andere Instrumente, so besaß der Universalgelehrte ein Klavier von Bartolomeo Cristofori aus dem Jahr 1724, das heute im Museo Nazionale degli Strumenti Musicali in Rom zu besichtigen ist. Marcello starb 1747 in Padua und wurde in der Villa Giusti begraben.
Alessandro Marcellos Werkkatalog ist deutlich kleiner als jener seines Bruders Benedetto. Unter seinen Instrumentalkomposition ragt insbesondere das in der MUSIK AM MITTAG musizierte Concerto per Oboe in re minore hervor, das durch Bachs für Cembalo transkribierte Fassung (BWV 974) große Popularität erlangte. Noch bis ins 19. Jahrhundert galt das Concerto als Werk Vivaldis, bevor es Benedetto Marcello und schließlich seinem Bruder Alessandro zugeschrieben wurde.
Marcellos dreisätziges Konzert (Andante e spiccato – Adagio – Presto) erschien 1717 bei Jeanne Roger in Amsterdam im Sammelband Concerti a Cinque con Violini, Oboè, Violetta, Violoncello e Basso Continuo, Libro Primo für verschiedene Soloinstrumente, zu dem auch Albinoni, Rampini, Valentini und Vivaldi Beiträge lieferten. Alessandro Marcello publizierte für gewöhnlich unter seinem Pseudonym Eterio Stinfalico, insofern hebt sich das Concerto auch hier von seinem restlichen Œuvre ab, denn die Veröffentlichung nennt seinen richtigen Namen. In der Musikwissenschaft wird das Concerto als erstes richtiges virtuoses solistisches Oboenkonzert der Geschichte betrachtet. In Marcellos Konzert ist die starre Bindung der Soloabschnitte an den Basso continuo aufgehoben: Die Solooboe wird von wechselnden Klangkombinationen begleitet. Das Andante e spiccato weist Merkmale der von Vivaldi geprägten Satzform des Concerto grosso auf, das Adagio präsentiert sich mit seinen Vorhalten und Tonwiederholungen durchaus spannungsreich.
Kraftvoll!
Niels Wilhelm Gade, 1817 in Kopenhagen als Sohn eines Schreiners und Instrumentenbauers geboren, entschied sich nach halbjähriger Lehre in der Werkstatt seines Vaters für eine Ausbildung zum Komponisten und Musiker. 1833 wurde er unbezahlter Violinschüler in Det Kongelige Kapel, was er bis 1843 blieb. Gades Fokus richtete sich auf das Komponieren und nicht auf eine Karriere als professioneller Violinist – so studierte er Musiktheorie und Komposition bei Andreas Peter Berggreen, dessen Idee der Übernahme des Volksliedes in die Kunstmusik Gades Musikschaffen prägte. In seine Studienjahre fallen viele Kompositionsübungen in Orchester-, Kammer-, Klavier- und Vokalmusik. Besonders bewunderte Gade Mendelssohn und Schumann – so berichtete Clara Schumann während ihres Kopenhagen-Aufenthalts am 31. März 1842 an ihren Mann Robert: „Gade besuchte mich heute und schwärmte von Dir. Er kennt alles von Dir, spielt alles (nach Kräften) selbst“ (zit. nach: Litzmann, Berthold (1905): Clara Schumann. Ein Künstlerleben. Band 2: Ehejahre 1840–1856. Leipzig: Breitkopf und Härtel. S. 48.). Nach Gewinn des ersten Preises beim Wettbewerb des Kopenhagener Musikvereins 1840 für sein Opus 1, die Ouvertüre Efertklange af Ossian, komponierte Gade 1841/42 seine Erste Symphonie, op. 5, die Mendelssohn begeistert entgegennahm und 1843 mit seinem Gewandhausorchester uraufführte. Ein Reisestipendium ermöglichte Gade eine Reise nach Leipzig, wo er sich schon bald im Kreis um Mendelssohn und Schumann bewegte, der ihn sehr prägte. Nach seinem Aufenthalt in Leipzig im Winter 1843/44 setzte Gade seine Europareise durch Deutschland, Österreich, Italien, die Schweiz und Frankreich fort. Nach seiner Rückkehr in die Heimat nahm er das Angebot an, in Leipzig neben Mendelssohn als Gewandhauskapellmeister die Gewandhauskonzerte zu leiten und am Konservatorium zu unterrichten. Bis Ende der Saison 1847/48 arbeitete er dort als Dirigent, Pädagoge und Komponist. Nach Ausbruch des Ersten Schleswig-Holsteinischen Krieges nach Kopenhagen zurückgekehrt hatte Gade eine Reihe wichtiger Ämter im städtischen Musikleben inne. Von 1850 bis zu seinem Tod leitete Gade die Konzerte des Musikforeningen, mit denen er einen wesentlichen Beitrag zur Volksbildung zu leisten beabsichtigte. Auch als Organist betätigte sich Gade, so war er ab 1851 als Organist an der Garnisons Kirke an einer Orgel aus dem Jahr 1724 von Lambert Daniel Kastens, die 1835/36 von Marcussen & Reuter renoviert worden war, von 1855 bis zu seinem Tod fungierte er als Organist der Holmens Kirke in Kopenhagen – trotz dieser langjährigen Tätigkeit komponierte Gade nur wenig für Orgel.
1861 war Gade neben seinem Schwiegervater Johann Peter Emilius Hartmann und Holger Simon Paulli Mitbegründer des Københavns Musikkonservatorium (ab 1901 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium), an dem er bis an sein Lebensende als Direktor und Professor für Komposition, Instrumentation und Musikgeschichte tätig war und unter anderem Carl Nielsen unterrichtete. Gade starb 1890 in seiner Heimatstadt Kopenhagen an einem Herzanfall – wenige Stunden zuvor hatte er noch bei einer Messe in der Holmens Kirke Orgel gespielt.
Theresa Zöpfl musizierte an der Rudigierorgel das Allegro aus Gades Drei Tonstücke, op. 22, zweifelsohne sein Hauptwerk für das Instrument Orgel. Gewidmet ist das Werk (Tre Tonestykker) seinem Schwiegervater. In einem Brief an Clara Schumann vom 6. September 1851 verrät der das dänische Musikleben des 19. Jahrhunderts prägende Gade nicht nur, dass statt eines „Einsiedlers“ nun ein „glücklicher Bräutigam“ schreibe, sondern erzählt auch etwas über sein Musikschaffen des Sommers 1851: „Mit meiner Musik geht es gut, Apoll und Amor stehen einander nicht fremd entgegen, dasz wissen Sie ja; ich habe diesen Sommer auszer vielen Kleinigkeiten eine Orgelsonate geschrieben, und schreibe jetzt an ein gröszeres Concertstück.“ (Niels Wilhelm Gade an Clara Schumann, Brief vom 6. September 1851. In: Danmarks Breve. URL.) Aus der erwähnten Orgelsonate strich Gade später einen Satz, transponierte zwei Sätze und wählte für die drei verbliebenen Stücke einen weniger an einen Zyklus erinnernden (und dadurch einen Vergleich mit Mendelssohns 1845 erschienenen Sechs Sonaten für Orgel, op. 65, unterbindenden) Titel und veröffentlichte sie 1852/53 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Verbindend!
Mit Ad Wammes Stück Faith musizierten Elisa Lapan und Theresa Zöpfl eine Originalkomposition für Sopransaxophon und Orgel. Das gesamt aus vier Sätzen (Argument – Prayer – Reconciliation – Rejoice) bestehende Werke wurde für das schwedische Duo Paulsson & Canning komponiert und von denselben am 22. Oktober 2010 in der Lutherse kerk Groningen uraufgeführt. Der 1953 im niederländischen Vreeswijk geborene Komponist verrät dazu: „The four parts of Faith form my personal plead for tolerance and understanding between the various different religious groups there are on this world.“ (Ad Wammes: Faith. URL.) Ad Wammes studierte Komposition bei Ton de Leeuw, Theo Loevendie und Klaas de Vries, Klavier bei Edith Lateiner-Grosz und elektronische Musik bei Ton Bruynèl. Bei der Symphonic-Rock-Band Finch spielte er Keyboard. Wammes kennt man als Komponist von fünf Alben der Sesamstraße (1983–1985). 1986 bis 2002 verantwortete er die Musik für 35 Serien von TeleacNOT hinsichtlich Komposition, Spiel und Aufnahme. Zuletzt widmete sich Wammes mehr der Komposition von Konzertmusik. Seine Orgelwerke sprechen dabei eine gemäßigt moderne Sprache und sind dominiert von tänzerischer Rhythmik.
Eine im wahrsten Sinne des Wortes orginelle und saxobefonte MUSIK AM MITTAG – Applaus, Applaus vom ORGEL.SOMMER-Publikum im Linzer Mariendom!
Stefanie Petelin
Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin