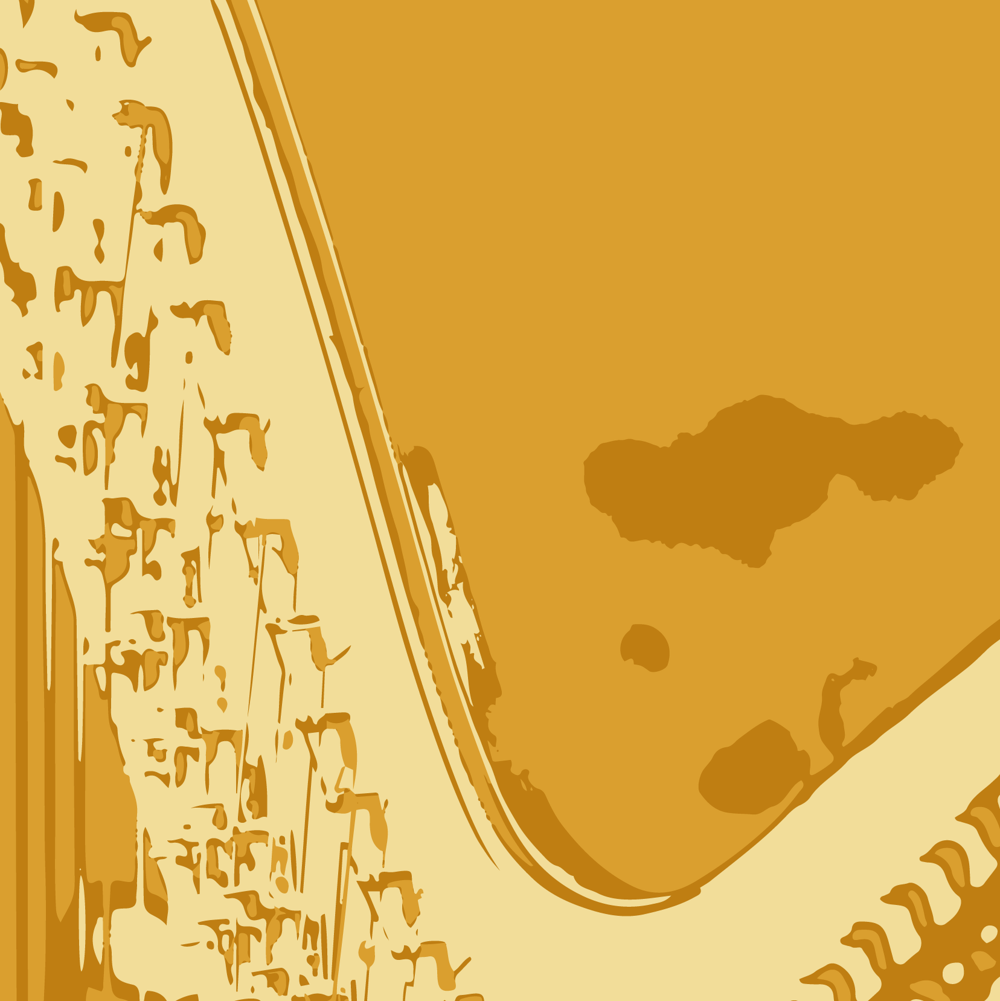AUS HERZ UND MUND mit Bettina Leitner-Pelster
Wie ein Orgelmusik-Best-of liest sich das Programm der aus Wels stammenden Organistin, die bei dieser MUSIK AM MITTAG ihr Debüt an der Rudigierorgel gab.
Berühmt!
Mit dem wohl bekanntesten Orgelstück der Welt eröffnete Bettina Leitner-Pelster ihre MUSIK AM MITTAG: Schon nach den ersten Tönen erkennt sie jede/r, die Toccata et Fuga in d, BWV 565, die durchaus als geheimnisumwobenes Rätsel der Musikgeschichte gilt. Zugeschrieben wird das ausdrucksstarke Werk nach wie vor dem jungen Johann Sebastian Bach, auch wenn die Autorschaft wohl nie final geklärt werden kann, da die Toccata et Fuga in d nur in einer einzigen Abschrift überliefert ist. Immer wieder wurden aus stilistischen Gründen Zweifel an Bachs Urheberschaft an dem Werk geäußert, u.a. von Roger Bullivant, Peter Williams und Rolf Dietrich Claus. Spekulationen und Ideen gab es dabei viele: Hat Bach ein fremdes Werk abgeschrieben oder bearbeitet? Handelt es sich um eine niedergeschriebene Improvisation Bachs? Ist es die Orgelbearbeitung einer Violinkomposition Bachs? Oder wer steckt sonst hinter dem durch seinen expressiven Charakter bestechenden Werk? Anders Christoph Wolff – er legt in seinen Ausführungen Argumente dar, die für ein Werk des jungen Johann Sebastian Bach sprechen. Sowohl Alte als auch Neue Bach-Ausgabe führen die Toccata et Fuga in d als Komposition Bachs, gesichert ist nur, dass die einzige zeitgenössische Quelle von Kellner-Schüler Ringk stammt.
Die drei charakteristischen Rufe am Beginn der gleichermaßen originellen wie populären Komposition stellen dabei bereits das melodische Material vor, mit dem im weiteren Verlauf gearbeitet wird; sie verdeutlichen bereits die stark auf Wirkung angelegte Konzeption des Werkes, dessen Teile durch deutliche motivische und harmonische Bezüge miteinander verbunden sind. Ungeachtet der Autorschaft des Werkes hat die Frische der Erfindung und die Vielfalt der Kontraste zwischen frei improvisierten und metrisch gebundenen Passagen, einstimmigen Linien und majestätischen Klangverdichtungen sowie Gesten und Fermaten dem Werk im Laufe der Geschichte viele Freunde und Freundinnen gemacht – nicht umsonst wird das Werk mannigfach in Filmen und anderen populärkulturellen Erzeugnissen zitiert, meist dann, wenn Ernsthaftigkeit oder sakrale Würde evoziert werden soll.
Freudig!
Mit Jesus bleibet meine Freude brachte Bettina Leitner-Pelster eine der bekanntesten Choralbearbeitungen Johann Sebastian Bachs zur Aufführung. Das Stück stammt aus Bachs Kantate Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147, die er in seinem ersten Jahr in Leipzig für das Fest Mariä Heimsuchung des Jahres 1723 komponierte. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung der für den vierten Advent 1716 in Weimar komponierten einteiligen Kantate gleichen Namens, von der nur der Text erhalten ist.
Für den Kantatenjahrgang 1723/1724 schuf Bach in erster Linie zweiteilige Kompositionen, die die Predigt umrahmten. Die Choralbearbeitung für vierstimmigen Chor, Streicher, Oboen und Trompete beschließt in BWV 147– musikalisch identisch – mit dem Text Wohl mir, dass ich Jesum habe (BWV 147, Nr. 6) den ersten Teil der Kantate, mit dem Text Jesus bleibet meine Freude (BWV 147, Nr. 10) den zweiten Teil der Kantate und unterstreicht damit die zweiteilige Anlage der Kantate. Bei den Texten handelt es sich um die sechste und siebzehnte Strophe von Martin Jahns Kirchenlied Jesu, meiner Seelen Wonne (1661). Gesungen wurde der Text mit unterschiedlichen Melodien – in Leipzig war es üblich, Jesu, meiner Seelen Wonne mit der Melodie von Johann Schops Werde munter, mein Gemüte (1642) zu singen. Diese Melodie nutzte Bach unter anderem auch in der Matthäus-Passion, BWV 244 (Nr. 48) und eben in der Kantate 147 als dreiertaktige Version. Maurice Duruflé bearbeitete das beliebte Stück, das zu den meistgespielten und meistarrangierten Bach-Stücken gehört, unter dem Titel CHORAL „Réjouis-toi, mon âme“ ou „Jésus, que ma joie demeure“ für Orgel.
Doppelt!
In Leitner-Pelsters MUSIK AM MITTAG schlossen sich zwei edle Kleinformen aus der Feder Bachs an, die Choralvorspiele über Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 730 und 731. Die beiden Choralbearbeitungen entstanden vermutlich in Bachs Weimarer Zeit zwischen 1708 und 1717 und beziehen sich auf das lutherische Kirchenlied Liebster Jesu, wir sind hier. Der Text des Liedes wurde 1663 von Tobias Clausnitzer verfasst: „Liebster Jesu, wir sind hier, // dich und dein Wort anzuhören; // lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, // daß die Herzen von der Erden // ganz zu dir gezogen werden.“ Die Musik des Lieder geht auf eine Melodie von Johann Rudolph Ahle aus dem Jahr 1664 zurück.
In Kontrapunktik, Harmonik und Kolorierung zeigen sich BWV 730 und 731 den Choralbearbeitungen des Orgelbüchleins ebenbürtig. Bei BWV 730 handelt es sich vermutlich um eine Frühform von BWV 731. In BWV 730 erklingt die Choralmelodie im ersten Abschnitt in einem fünfstimmigen Choralsatz im Sopran, im zweiten Abschnitt wird die Melodie koloriert und blüht in ihrer Schreibart zusehends auf. BWV 731 stellt den Cantus firmus in einem reich kolorierten Solo vor.
Inspiriert!
Mit einem Höhepunkt der französischen Orgelmusik und fast einer Punktlandung zum Jahrestag der Uraufführung beschloss Bettina Leitner-Pelster ihre MUSIK AM MITTAG ganz AUS HERZ UND MUND: Denn fast auf den Tag genau vor 144 Jahren erklang Charles-Marie Widors sechste Symphonie in g-Moll (Symphonie VI, sol mineur), op. 42/2, zum ersten Mal. Der Komponist führte das für seine Zeit auffallend fortschrittliche Werk am 24. August 1878 im Beisein von Franz Liszt beim fünften Einweihungskonzert der Cavaillé-Coll-Orgel im Salle des fêtes des Palais du Trocadéro im Rahmen der Pariser Weltausstellung auf – noch unter dem Namen 5eme Symphonie (1re audition). Komponiert hatte Widor das fünfsätzige Werk zwischen seinem Besuch der ersten Bayreuther Festspiele im August 1876 und dem Sommer 1878.
Zum ersten Mal öffnet Widor in seiner sechsten Symphonie, die vor seiner fünften Symphonie entstand und von Widor zugunsten einer konsequenten Ordnung der Tonartenfolge (statt einer Entstehungschronologie) bei der Drucklegung nach hinten gereiht wurde, eine Orgelsymphonie in Sonatenhauptsatzform. Dieses eröffnende Allegro präsentiert sich dabei als inspiriertes und mitreißendes Stück, das der Orgel in seiner leidenschaftlichen Beweglichkeit und nichtablassenden Vitalität eine bis dahin unerschlossene Ausdruckswelt öffnete. „Widor ist dabei ein seriöser Künstler zu werden!“ (zit. n.: Van Oosten, Ben (1997): Charles-Marie Widor. Vater der Orgelsymphonie. Paderborn: Verlag Peter Ewers. S. 497.), soll Jacques-Nicolas Lemmens gegenüber Aristide Cavaillé-Coll ausgerufen haben, als er Widors sechste Symphonie in Paris hörte.
Der 1844 in Lyon geborene Widor, der später durch sein Wirken am Conservatoire de Paris eine französische Orgelschule begründete, war erst Ende der 1860er-Jahre nach Paris gezogen, wo er im Januar 1870 – durch Unterstützung von Aristide Cavaillé-Coll, Charles Gounod und Camille Saint-Saëns – die Nachfolge Louis James Alfred Lefébure-Wélys an der Cavaillé-Coll-Orgel von Saint-Sulpice antrat. Die Anstellung war zunächst auf ein Jahr befristet – und obwohl diese provisorische Anstellung offiziell nie aufgehoben wurde, blieb Widor fast 64 Jahre Organist in der Kirche von Saint-Sulpice! Deren Cavaillé-Coll-Orgel erwies sich für den komponierenden Organisten zeitlebens sehr inspirierend, wie er festhielt: „Hätte ich die Verführung dieser Klangfarben, den mystischen Reiz dieser Klangwelle nicht empfunden, so hätte ich nie Orgelmusik geschrieben.“ (zit. n.: Van Oosten, Ben (1997): Charles-Marie Widor. Vater der Orgelsymphonie. Paderborn: Verlag Peter Ewers. S. 106.) Und das hätte auch das ORGEL.SOMMER-Publikum im Linzer Mariendom sehr bedauert – lautstarker Applaus für Bettina Leitner-Pelster!
Charles-Marie Widor (1844–1937): Symphonie No. 6 en sol mineur, op. 42/2: 1. Allegro | Rudigierorgel: Bettina Leitner-Pelster
Stefanie Petelin
Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin