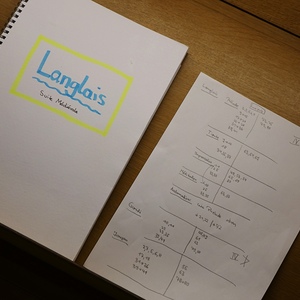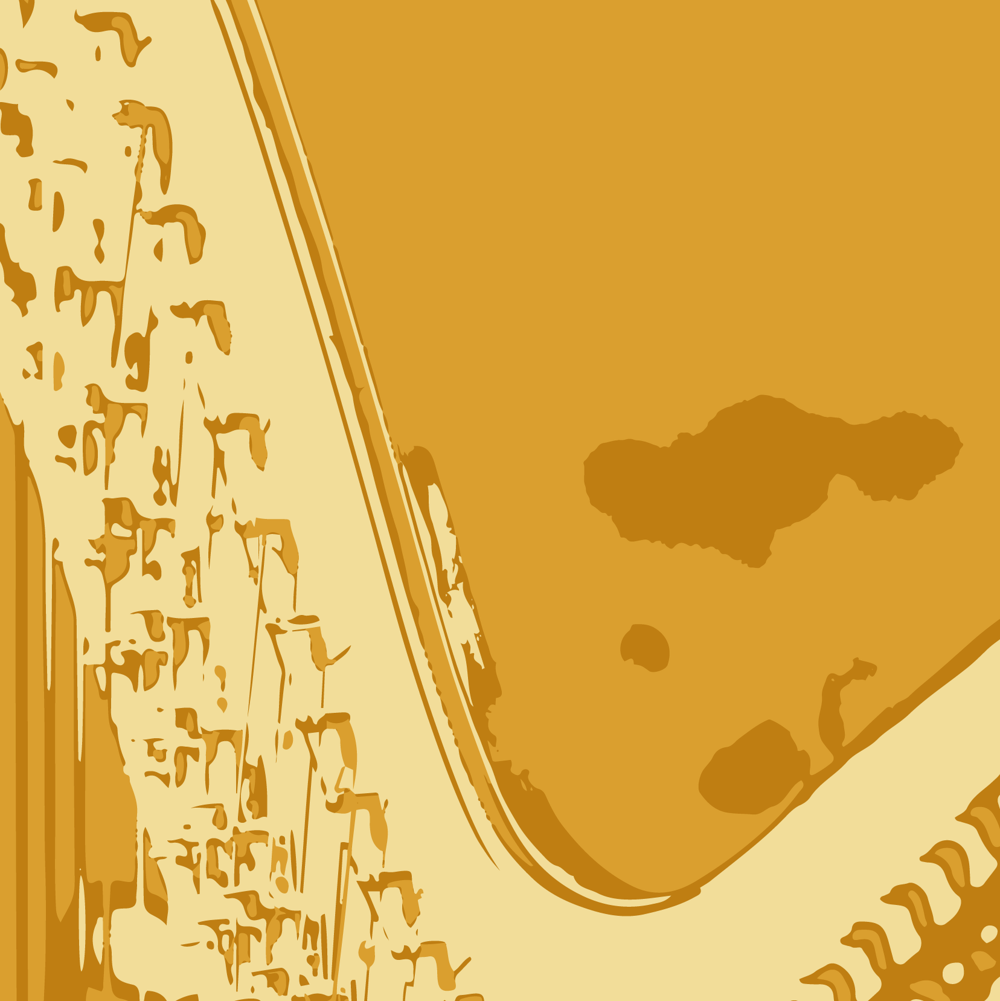ORGELOQUENT mit Willibald Guggenmos
ORGELOQUENT präsentierte sich der St. Gallener Domorganist Willibald Guggenmos in seinem bunten Programm, in dem er natürlich auch dem „Jahresregenten“ César Franck Reverenz erwies.
Gregorianisch!
Das Konzert eröffnete der gebürtige Bayer Guggenmos mit Jean Langlais' Suite Médiévale, op. 56. Jean Langlais, 1907 in La Fontanelle geboren, erblindete bereits im Kindesalter. 1917 erhielt er ein Stipendium für die Institution Nationale des Jeunes Aveugles, wo er ab 1923 Orgelunterricht bei André Marchal erhielt. 1927 bis 1930 studierte er bei Marcel Dupré am Conservatoire de Paris und nahm Improvisationsstunden bei Charles Tournemire. 1945 wurde Langlais Organist an der Cavaillé-Coll-Orgel von Sainte-Clotilde und komplettierte als Nachfolger Francks und Tournemires die Tradition der komponierenden Organisten dieser Basilika, deren Orgel am Ende von Tournemires Amtszeit vergrößert worden war. Langlais‘ Suiten entstanden aus dem Wunsch, größere Werke für das Instrument zu schaffen. Mit der Suite Médiévale komponierte Langlais 1947 ein liturgisches Werk für die messe basse, wie der Untertitel en forme de messe basse verrät. Messe basse beschreibt die Form der vorkonziliaren französischen Sonntagsmesse, deren liturgischer Ablauf nahezu ein Rezital an der Orgel ermöglicht. Gewidmet ist die in fünf Sätze mit Doppeltitel gegliederte Suite, mit der ihr Schöpfer an die Tradition französischer Orgelsuiten anknüpft, Langlais‘ Orgellehrer André Marchal.
Langlais folgt in der Anlage der von Tournemire in L’Orgue Mystique entwickelten Formel, gregorianische Themen zum Tag in einer fünfteiligen Struktur auszudeuten. Anders als Tournemire wählt Langlais für das gesamte Kirchenjahr geeignete gregorianische Elemente aus, um sie in neo-mittelalterlicher Ästhetik zu verarbeiten. Nach einem prächtigen Prélude, in das der Gesang Asperges me, Domine gewebt ist, folgt mit dem Tiento ein Werk für das Offertorium. Darin verneigt sich Langlais musikalisch vor der spanischen Tastenmusik des 16. und 17. Jahrhunderts und bezieht darüber hinaus den Kyrie-Tropus Fons bonitatis als Anerkennung der mittelalterlichen Praxis des Tropierens mit ein. In der für die Wandlung bestimmten Improvisation stellt Langlais den Hymnus Adoro te vor. Die Isolation dieses Fragments verleiht ihm dabei besondere Bedeutung, wie Pater Patrick Giraud bemerkt: „To the extent that a Gregorian citation loses importance in length, it gains interest by being merely a small gem in its frame.“ Den liturgischen Moment der Kommunion hebt Langlais in der Méditation durch die Verarbeitung der Antiphon Ubi caritas, die er mit dem Hymnus Jesu dulcis memoria verbindet, hervor, wobei er auf eine von Franck abgeleitete Technik zurückgreift. Dem Postludium liegen Fragmente der Laudes Regiae zugrunde: Die Melodie der Worte Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat wird im Wechsel mit der Phrase Exaudi Christi unter Verwendung eines aufsteigenden harmonischen Musters verarbeitet. Das Stück endet mit einem Pedalglockenspiel, das die Christus-Litanei überlagert und von den Glocken der Kathedrale von Reims inspiriert ist. Langlais‘ enge Bindung an die katholische Kirche zu einer Zeit, in der diese tiefgreifende Veränderungen erlebte, prägte sein Schaffen wesentlich. Der liturgische Kontext der Suite Médiévale existiert seit der Liturgiereform zwar nicht mehr, das Werk repräsentiert jedoch hervorragend Langlais‘ Stil. Mit kurzen Sätzen, vielfältigen Klangfarben und Gregorianikfragmenten illustriert die Suite seinen Anspruch, nicht nur Komponist, sondern gleichzeitig auch Theologe zu sein. Dies konnte man aus Willibald Guggenmos' Interpretation wunderbar „heraushören“.
Bretonisch!
Bretonische Klänge folgten mit einem Werk von Joseph Guy Ropartz. 1864 im bretonischen Guingamp als Sohn eines Juristen geboren, schlug Ropartz beruflich zunächst den Weg seines Vaters ein. Nach seiner Zulassung als Anwalt 1885 trat er jedoch ins Conservatoire de Paris ein und studierte Orgel bei César Franck, nachdem er Vincent d’Indys Le Chant de la Cloche gehört und dessen Lehrmeister in Erfahrung gebracht hatte. 1894 übernahm Ropartz die Leitung des Conservatoire de Nancy, 1919 bis 1929 war er Direktor des Conservatoire de Strasbourg und Chefdirigent des heutigen Orchestre philharmonique de Strasbourg. Nach seiner Pensionierung 1929 kehrte Ropartz in seinen bretonischen Landsitz in Lanloup zurück, wo er sich bis zu seiner Erblindung 1953 dem Komponieren widmete, bevor er 1955 starb. Louis Kornprobst sah drei Inspirationsquellen für den Komponisten: die Bretagne, das Meer und den Glauben.
Bei der Invocation à César Franck in C-Dur handelt es sich um das erste Stück (Molto Tranquillo) der 1919 veröffentlichten und „mon ami A. Dupont“ gewidmeten Sammlung Au Pied de l’Autel. Ropartz zielte mit dieser 60 Stücke umfassenden Sammlung, die 1916 und 1917 in Lay-Saint-Christophe entstand, darauf ab, „wahrhaft religiöse Musik“, die doch leicht aufführbar ist, für die Verwendung in der Liturgie zu schaffen.
Bachisch!
Über Johann Sebastian Bachs Biographie müssen wohl keine Worte verloren werden, der Blick richtet sich daher direkt auf sein Werk: Wie bei vielen anderen Präludien und Fugen Bachs ist auch bei Präludium und Fuge c-Moll, BWV 546, kein Autograph des Komponisten erhalten, die älteste bekannte Partitur stammt von Johann Peter Kellner. Das monumentale Präludium entstand wohl in Bachs Leipziger Zeit (ab 1723), wie strukturelle Ähnlichkeiten zu Präludien dieser Zeit nahelegen, und vereinigt in sich alle Kriterien eines Meisterwerks; hervorzuheben sind vor allem der klare, sonatensatzähnliche Aufbau sowie die stilistische und thematische Einheit. Über die fünfstimmige Alla-breve-Fuge gehen die Meinungen durch darin enthaltene stilistische Anomalien jedoch auseinander: Entstand sie bereits in Bachs Weimarer Zeit? Wurde sie ursprünglich mit einem anderen Präludium gepaart? Hat Kellner Bachs Fuge gar bearbeitet? Oder stammt sie vielleicht überhaupt aus seiner Feder? Auch wenn die Fuge gelegentlich als weniger geschlossen und inkonsequenter gestaltet empfunden wird – ihrer musikalischen Schönheit tut dies keinen Abbruch, wie die nachfolgende Hörprobe eindrucksvoll verdeutlicht:
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Präludium und Fuge c-Moll, BWV 546 | Rudigierorgel: Willibald Guggenmos
Baskisch!
Gen Süden reiste Guggenmos musikalisch. Denn Jesús Guridi Bidaola, Urenkel des Komponisten Nicolás Ledesma, wurde 1886 im baskischen Vitoria-Gasteiz als Sohn eines Geigers und einer Pianistin geboren. Mit fünf Jahren schrieb er bereits erste musikalische Ideen nieder. Nach dem Umzug der Familie nach Madrid genoss er Harmonielehreunterricht, sodass er das Komponieren bald beherrschte und mit elf Jahren bereits einige Stücke auf seiner Werkliste verzeichnen konnte. Nach einer Ausbildung in Bilbao studierte Guridi Bidaola zwischen 1904 und 1906 an der Schola Cantorum in Paris Orgel, Komposition, Kontrapunkt und Fuge, ab 1906 Komposition und Orgel bei Joseph Jongen in Lüttich sowie Orchestration bei Otto Neitzel in Köln. Anschließend ließ er sich in Bilbao nieder, wo er an der Basilika del Señor Santiago in Nachfolge seines Urgroßvaters als Organist, an der Sociedad Coral als Leiter sowie als Orgel- und Kompositionslehrer am Conservatorio Vizcaíno de Música tätig war. Nach dem spanischen Bürgerkrieg lebte er in Madrid und wirkte als musikalischer Direktor der Ulargui Films S. A. sowie als Professor für Orgel am Real Conservatorio Superior de Música, dessen Leiter er von 1956 bis zu seinem Tod 1961 war. 1952 erklärte ihn der Stadtrat seines Geburtsortes im Rahmen einer mehrtägigen Hommage zum „Lieblingssohn der Stadt“ und taufte das städtische Konservatorium auf seinen Namen.
Auch wenn sich der Baske zeitlebens mit nahezu allen musikalischen Gattungen beschäftigte und sich symphonischen und szenischen Werken ebenso zuwandte wie Kammermusik oder Kinderliedern: Sein Lieblingsinstrument war die Orgel. Unter den Kompositionen für dieses Instrument ragen die Variaciones sobre un tema vasco von 1948, die Gloria López Sallaberry de Viani gewidmet sind, besonders hervor. Nach der Vorstellung des Themas, dem baskischen Volkslied Itsasoan, entwickelt Guridi Bidaola neun faszinierende, dramaturgisch verdichtete Variationen, bei denen man nahezu glauben kann, den Komponisten selbst improvisieren zu hören ...
Mystisch!
Mystische Klänge folgten auf Guridis kraftvolle Variationen. Mit den zwischen 1856 und 1864 entstandenen Six Pièces pour Grand Orgue leitete César Franck eine Revolution ein: Er erneuerte die Ästhetik der Orgel hinsichtlich Komposition, Form und Behandlung des Instruments. Franck führte die Stücke, von denen jedes hinsichtlich Charakter, Gattung und Form individuell gestaltet ist, zum ersten Mal am 17. November 1864 in Sainte-Clotilde auf. Franck entfaltet in ihnen seine unverkennbare Tonsprache, die mit klassischen deutschen Traditionen von Bach und Beethoven verbunden ist, aber auch Einflüsse von Zeitgenossen wie Berlioz, Liszt und Wagner zeigt.
Sein um 1860 komponiertes Prière, CFF 100, widmete er François Benoist, seinem Orgellehrer am Conservatoire de Paris. Mit Prière benutzte Franck einen Werktitel, der ab der 1862 von Jacques-Nicolas Lemmens herausgegebenen Orgelschule weite Verbreitung im französischsprachigen Raum fand. Durch seine Bedeutung („Gebet“) verleiht der Titel den oft der Improvisation nahestehenden Werken den Charakter religiöser Meditationen.
Bei Francks Prière handelt es sich aufgrund der Tonart cis-Moll um ein düsteres Gebet, so interpretiert Norbert Dufourcq das Stück als „gewaltige Meditation über die Idee des Schmerzes“, die trotz wiederkommender heller Dur-Momente schnell nach Moll zurückkehrt und „den Glaubenden erneut in den aus Mystik und Furcht bestehenden Zustand der Ungewissheit zurückversetzt“. Auch wenn der fünfstimmige Satz für alle Organist:innen schwierig ist, für jene mit kleinen Händen ist er eine besondere Herausforderung: So war es selbst dem berühmten Louis Vierne unmöglich, die ersten 32 Takte an den Manualen zu musizieren. Er zog bis Takt 33 keine Pedalregister, spielte die tiefste Stimme im Pedal und verteilte die vier anderen Stimmen auf seine Hände.
Toccatastisch!
Lauter wurden die Töne wieder mit Joseph Jongens Toccata in Des-Dur, op. 104. Joseph Jongen, 1873 in Lüttich geboren, trat bereits mit sieben Jahren in das Conservatoire Royal de Liège in seiner Heimatstadt ein, wo er seine musikalische Ausbildung in Komposition, Orgel und Klavier erhielt. 1898 bis 1904 versah er zusammen mit seinem jüngeren Bruder Léon den Dienst als Organist an der Lütticher Kirche Saint-Jacques. Der belgische Prix de Rome 1897 ermöglichte ihm eine mehrjährige Reise durch Deutschland, Frankreich und Italien, auf der er die Musik von Johannes Brahms kennenlernte, Kompositionsstunden bei Richard Strauss nahm und mit Charles Bordes, Gabriel Fauré und Vincent d’Indy Bekanntschaft machte. Jongen ließ sich 1905 in Brüssel nieder, lehrte am Lütticher Konservatorium, wo er 1911 zum Professor für Harmonielehre ernannt wurde und unter anderem Guridi Bidaola unterrichtete. Nach dem Ersten Weltkrieg, den Jongen mit seiner Familie in London und Bournemouth verbrachte, wo er das Quatuor belge de Londres gründete und auch regelmäßig Klavier- und Orgelkonzerte gab, wurde er 1920 am Conservatoire royal de Bruxelles zum Professor ernannt. 1925 bis zu seiner Pensionierung 1939 fungierte er als Direktor dieser Einrichtung. Jongen starb 1953 in seinem Sommerhaus in Sart-lez-Spa.
Internationale Bekanntheit verdankt Jongen hauptsächlich seinen Orgelwerken, die gekennzeichnet sind vom Bemühen um Beherrschung der Form und harmonische Farbigkeit. Léon Jongen betonte zwar die Unabhängigkeit seines Bruders von César Franck, die Verwurzelung in dessen Schule ist jedoch wahrnehmbar, auch in seiner 1935 entstandenen Toccata, die Jongens Freund Georges Alexis gewidmet ist. In einer Anmerkung zum Stück bemerkt der Komponist, dass sich das Stück nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch an Raum und Instrument angepasste Regelmäßigkeit, mit der die Akkorde von beiden Händen gespielt werden, auszeichnet.
Die Fähigkeit, sich ORGELOQUENT an Werk, Raum und Instrument anzupassen, zeigte Guggenmos in seinem ORGEL.SOMMER-Konzert auf beeindruckende Weise: Ob barock mit Bach, romantisch mit Franck, spanisch mit Guridi Bidaola oder gregorianisch mit Langlais – der Domorganist der Kathedrale St. Gallen beherrscht sein „Hand- (und Fuß-)werk“. Dafür gab's Standing Ovations vom ORGEL.SOMMER-Publikum – und als musikalischen Dank mit Benedetto Marcellos I cieli immensi narrano (in einer Orgelbearbeitung von Théodore Dubois) eine pfiffige Zugabe von Willibald Guggenmos! Fazit: Einfach ORGELOQUENT!
Stefanie Petelin
Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin