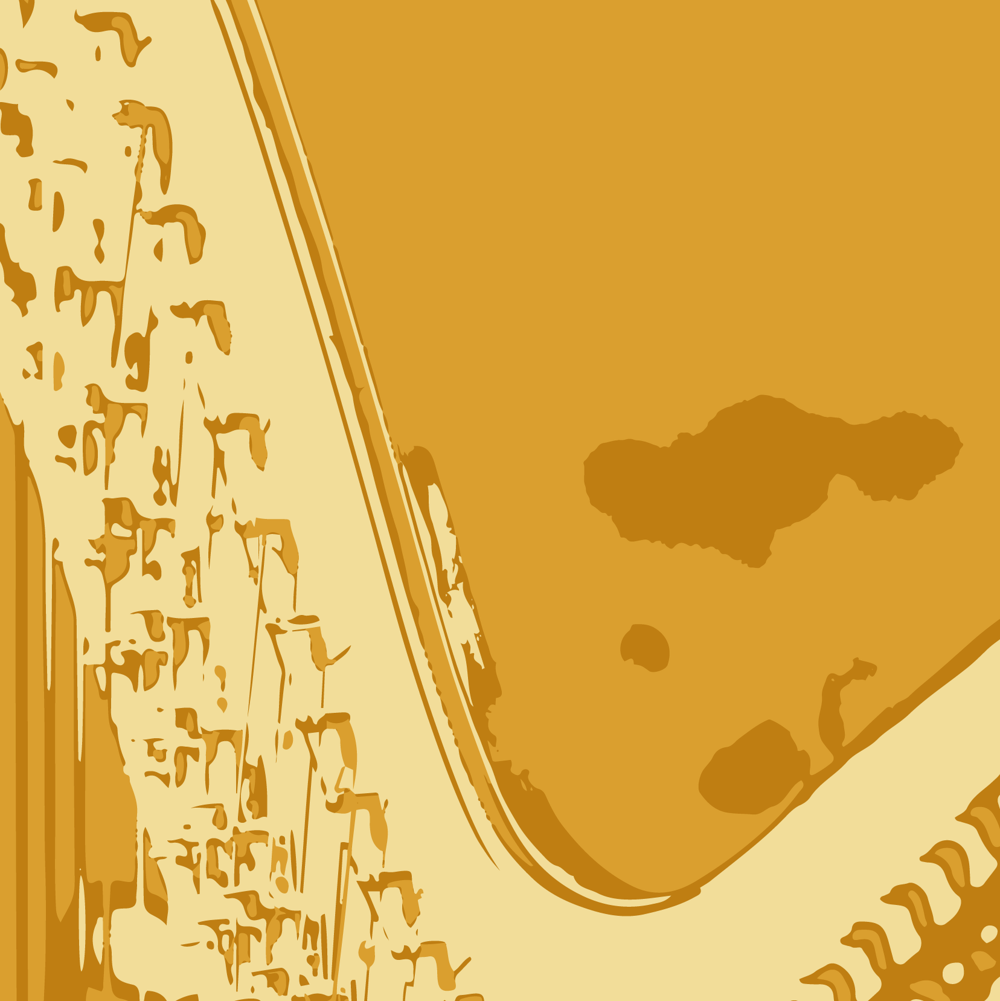ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE mit Sarah-Maria Pilwax
„Die Rudigierorgel ist für mich ein Meilenstein, den ich schon immer erreichen wollte“, hatte Sarah-Maria Pilwax vorab im ORGEL.SOMMER-Interview verraten. Bei ihrer Premiere an „einer der herrlichsten Orgeln der Welt“ (Gaston Litaize) im Rahmen der MUSIK AM MITTAG am 14. August 2022 im Linzer Mariendom begeisterte die junge Niederösterreicherin mit ihrem Konzertprogramm, das sich angesichts des bevorstehenden Feiertags Mariä Aufnahme in den Himmel mit Werken von Johann Sebastian Bach, Dieterich Buxtehude und Max Reger ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE bewegte.
Lobend!
Mit der fünfteiligen Komposition Te Deum laudamus, BuxWV 218, die als Dieterich Buxtehudes größtes und umfangreichstes Orgelwerk betrachtet werden kann und in sich alle Qualitäten und Errungenschaften der norddeutschen Orgelschule vereinigt, eröffnete Sarah-Maria Pilwax ihre MUSIK AM MITTAG an der Rudigierorgel. Das mit originellen Zügen und kompositorischer Kühnheit gesegnete Stück basiert dabei auf vier Versen aus dem lateinischen Te Deum (Te Deum laudamus, V. 1; Pleni sunt coeli, V. 6; Te martyrum, V. 9; Tu devicto, V. 17). Da Buxtehude nur ausgewählte Verse des Te Deum vertont hat, ist davon auszugehen, dass die Komposition nicht liturgisch, sondern künstlerisch motiviert war, zumal die Komposition auf der lateinischen Fassung des Chorals basiert, die man in vielen großen lutherischen Kirchen in Norddeutschland zwar kannte, in Buxtehudes Heimatstadt Lübeck aber nicht benutzte.
Ein eigenständiges Präludium mit einem fugierten Abschnitt geht der Vertonung der vier Te-Deum-Verse voraus, in denen Buxtehude schließlich alle ihm zur Verfügung stehenden Bearbeitungstechniken zur Anwendung bringt – in den zwei- bis sechsstimmigen Sätzen präsentiert Buxtehude Fuge und Fugato, mehrfachen Kontrapunkt, Ostinato, Monodie und Echo. Das Zentrum des Werkes bildet der als große Choralfantasie ausgedeutete Vers Pleni sunt coeli.
Marianisch!
Den bevorstehenden Marienfeiertag nahm Pilwax zum Anlass für die Interpretation von Max Regers Ave Maria aus der Sammlung Monologe, op. 63. Reger war Anfang August 1901 mit seinen Eltern nach München übersiedelt. Dort entstanden 1901 und 1902 die unter dem Titel Monologe zusammengefassten zwölf Stücke in drei Heften. Das im Konzert musizierte Ave Maria findet sich als Nummer sieben in dem Hermann Robert Frenzel zugeeigneten zweiten Heft. „Akkordarbeiter“ Reger verfasste diese kürzeren, leichter spielbaren Werke mit der Intention, seinen Namen bekannter zu machen und die bis dahin entwickelten Elemente seiner Tonsprache besonders charakteristisch zu präsentieren.
Durch Alexander Wilhelm Gottschalg kam Reger im August 1901 mit Constantin Sander, Eigentümer des Leipziger Verlags F.E.C. Leuckart in Kontakt, der schon bald an einer längerfristigen Zusammenarbeit mit dem Komponisten interessiert gewesen sein dürfte. Anfang Dezember 1901 kündigte Reger in einem Brief an seinen Lehrer und Freund Adalbert Lindner „kleinere Stücke à la op 59“ an (Brief Regers vom 4. und 12. Dezember 1901 an Adalbert Lindner, Stadtmuseum Weiden, Max-Reger-Sammlung, Signatur: L 35). Dokumentiert ist die Entstehung der Komposition nicht – erst am 22. April 1902 rund um die Beendigung der Niederschrift erscheint erstmals der Hinweis auf das Sammelwerk „op 63 ‚Monologe‘ 12 Stücke für Orgel (56 Seiten) gehen in 8 Tagen an den Verlag Leuckart“ (Postkarte Regers vom 22. April 1902 an Theodor Kroyer, Staatliche Bibliothek Regensburg, Signatur: IP/4Art.714). Mitte Juni saß Reger bereits über den Korrekturbögen des ersten Hefts, wie er seiner späteren Frau Elsa schrieb: „Gott sei Dank, meine Correkturbögen hab ich alle erledigt – aber es dauert nicht lange – dann kommen noch viel mehr! O, Schatz, das ist eine fürchterliche Arbeit!“ (Regers Brief an Elsa von Bercken, geb. von Bagensteg, vom 18. Juni 1902, Max-Reger-Institut, Signatur: Ep. Ms. 1728.) Beworben wurden die Monologe mit folgenden Worten des Verlags Leuckart: „In diesen zwölf Stücken, wovon jedes einzelne ein in sich abgeschlossenes Stimmungsbild von intensiver Stärke entrollt, werden an die Technik des Spielers keine grossen Anforderungen gestellt. Zur ersten Einführung in die gewaltige Kunst Reger’s sind daher seine Monologe so geeignet wie kaum ein anderes seiner Werke und darum ganz besonders willkommen und empfehlenswert.“ (Verlagsprospekt, Max-Reger-Institut, Signatur: D. Ms. 234)
Der ungewöhnliche Titel Monologe für die Sammlung von Zwölf Stücken für die Orgel erinnert an Josef Rheinbergers Opus 162 aus dem Jahr 1890. Auch wenn Reger Rheinberger vor dessen Tod am 25. November 1901 in München noch kennenlernte, ist eine explizite Bezugnahme auf dessen gleichnamiges Werk nicht belegt.
Erhebend!
Mit Johann Sebastian Bachs Komposition Fuga sopra il Magnificat, BWV 733, wendete sich Sarah-Maria Pilwax zum Finale ihrer MUSIK AM MITTAG erneut der Gottesmutter Maria zu. Bach legt seiner Fuge den Vers „Meine Seele erhebt den Herren, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes“ (Lk 1, 46f) zugrunde. Angesichts des Titels würde man vielleicht eine prominentere Funktion der Melodie in diesem Orgelwerk erwarten, doch das im neunten Psalmton stehende Magnificat erweist sich beharrlich. Es wird in Form einer Fuge – der Tradition Pachelbels folgend – durchgeführt, wobei sich das Thema in der Vergrößerung im Pedal zeigt. Den insgesamt fünfstimmigen Satz kennzeichnet neben der hohen Kontrapunktik eine die gesamte Fuge durchlaufende Achtelbewegung. Jean-Claude Zehnder datiert die Fuge in Bachs Weimarer Zeit, teilweise wird die Echtheit der Komposition allerdings auch angezweifelt und Johann Ludwig Krebs zugeschrieben.
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Fuga sopra il Magnificat, BWV 733 | Rudigierorgel: Sarah-Maria Pilwax
Sarah-Maria Pilwax' irdisch-himmlisches Konzert der Matineereihe mit Bach, Buxtehude und Reger wurde mit kräftigem Applaus des ORGEL.SOMMER-Publikums belohnt.
Wolfgang Kreuzhuber/Stefanie Petelin
Dommusikverein Linz/Stefanie Petelin